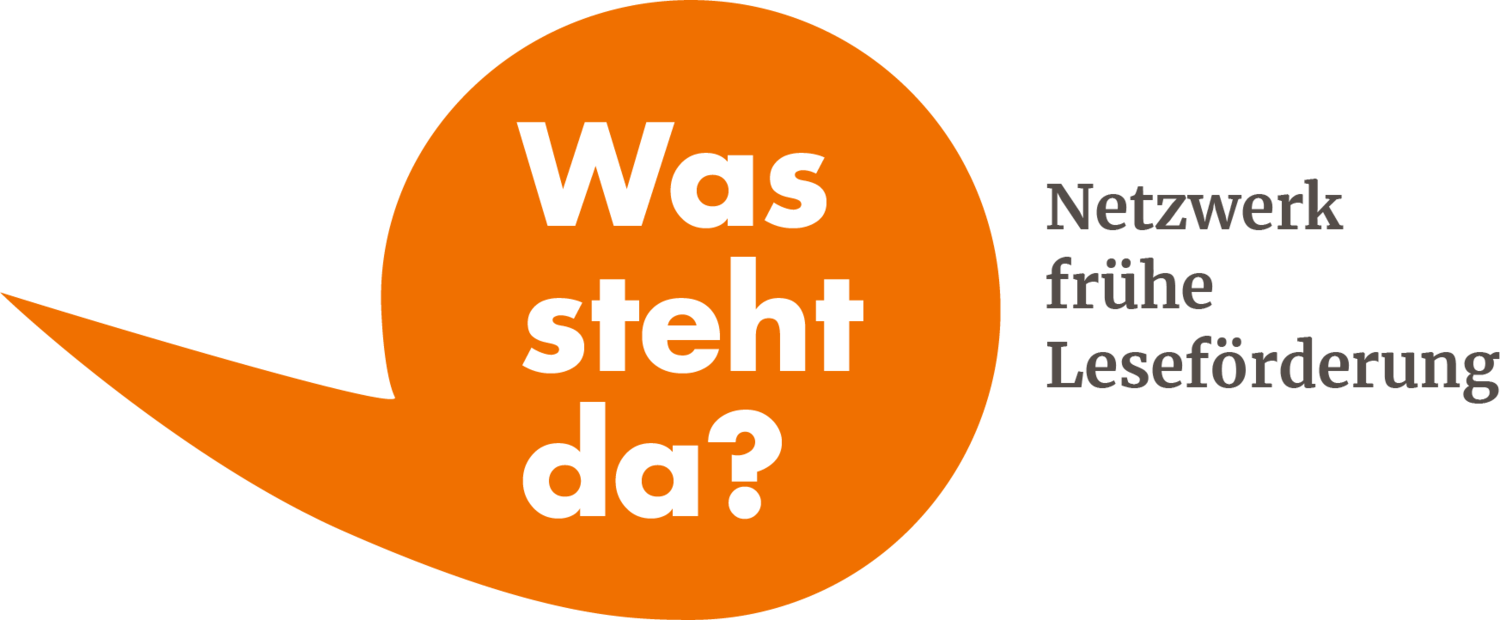Sechs Strategien zur Stärkung der frühen Leseförderung in Österreich
Seit dem 3. März 2025 hat Österreich eine neue Regierung, die mit ambitionierten Initiativen im Bereich Elementarbildung und schulischer Förderung ihre Arbeit aufgenommen hat. Das österreichweite Netzwerk zur frühen Leseförderung “Was steht da?“ begrüßt diese Vorhaben und möchte sie tatkräftig mit seinem Know-how und seiner Praxiserfahrung unterstützen. Dieses durch “Was steht da?” entwickelte Dokument stellt sechs Strategien zur Stärkung der frühen Leseförderung in Österreich vor.
Die Förderung der Lesekompetenz und der Lesefreude ist eine zentrale gesellschaftliche Verantwortung, die bereits mit der Geburt eines Kindes beginnt. Die zunehmende Digitalisierung hat den Begriff der Lesekompetenz stark verändert und erfordert neue, innovative Konzepte, um Kinder und Familien bestmöglich zu unterstützen.
Um dieser Verantwortung gerecht zu werden, braucht es ein entschlossenes Handeln: ein breites, aber auch gezielt maßgeschneidertes Angebot für Familien, elementare Bildungseinrichtungen und alle Akteur:innen, die sich für die Leseförderung engagieren.
Ebenso wichtig ist die Schaffung eines kollektiven Bewusstseins dafür, dass Lesen weit mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung. Es ist der Schlüssel zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft als selbstständige Bürger:innen sowie zu schulischem und beruflichem Erfolg.
Um diese Transformation zu ermöglichen, sind nicht nur finanzielle Mittel erforderlich, sondern auch kreative und innovative Ansätze. Die notwendigen Mittel dürfen dabei nicht als bloße Ausgaben betrachtet werden, sondern müssen als nachhaltige Investitionen mit spürbaren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Effekten verstanden werden.
Leseförderung bedeutet nicht nur Bildung, sondern die Gesellschaft zu fördern und sollte daher höchste politische Priorität genießen – auch, um einem drohenden wirtschaftlichen Abstieg Österreichs und Europas wirksam entgegenzusteuern.
1
Familien fördern und unterstützen
Lesen beginnt zu Hause, doch nicht alle Familien verfügen über die notwendigen Ressourcen oder das Wissen, wie sie die Lese- und Sprachkompetenz ihrer Kinder früh fördern können. Daher braucht es eine breit angelegte, bundesweite Kampagne zur Bewusstseinsbildung, die die Bedeutung der frühen Leseförderung in den Mittelpunkt stellt.
2
Zugang von Familien zu Büchern sicherstellen
Der Zugang zu Büchern ist eine wesentliche Voraussetzung für die Leseförderung. Familien müssen die Möglichkeit haben, ohne finanzielle Hürden auf eine vielfältige Auswahl an aktuellen Kinderbüchern zuzugreifen. Bibliotheken und Büchereien einschließlich jener in Schulen und elementaren Bildungseinrichtungen spielen dabei eine zentrale Rolle und müssen besser ausgestattet werden. Auch die Einbindung der Frühen Hilfen in die Leseförderung kann Familien früh erreichen. Programme wie Buchstart sind bewährte Modelle und müssen langfristig finanziell gesichert und ausgebaut werden. Kein Kind darf aufgrund sozialer oder wirtschaftlicher Barrieren vom Zugang zu Büchern ausgeschlossen sein. Für Schulbibliotheken und jene in elementaren Bildungseinrichtungen fordern wir einen gesetzlich verankerten Lese-Etat und geschultes Personal bzw. Personalstunden.
3
Mehr finanzielle Ressourcen und einheitliche Standards für die Elementarpädagogik
Die frühe Leseförderung bildet die Grundlage für die spätere Bildungsbiografie eines Kindes. Trotz dieser zentralen Bedeutung fehlt es in Österreich an ausreichenden finanziellen Mitteln, um allen Kindern qualitativ hochwertige frühe Leseförderung zu ermöglichen. Daher fordern wir eine deutliche Aufstockung der finanziellen Ressourcen für die Elementarpädagogik, insbesondere im Bereich der Sprach- und Leseförderung. Zusätzlich müssen bundesweit einheitliche Qualitätsstandards eingeführt werden, um sicherzustellen, dass jedes Kind unabhängig von Wohnort oder sozialem Hintergrund die gleichen Chancen erhält.
4
Mehr Fachkräfte in der Elementarpädagogik
Die sprachliche Entwicklung eines Kindes beginnt lange vor dem Schuleintritt und ist entscheidend für den weiteren Bildungserfolg. Es braucht daher mehr gut ausgebildete Fachkräfte, die gezielte Sprach- und Leseförderung in elementaren Bildungseinrichtungen umsetzen können. Ohne eine signifikante Aufwertung der Berufsbilder kann keine nachhaltige Verbesserung erzielt werden.
5
Bessere Vernetzung zwischen Kindergarten und Schule
Der Übergang vom Kindergarten in die Volksschule ist eine kritische Phase in der Bildungsbiografie eines Kindes. Fehlt eine koordinierte Anschlussförderung, können sprachliche und literale Fortschritte ins Stocken geraten oder verloren gehen. Eine enge Zusammenarbeit zwischen Elementarpädagogik und Volksschulen ist daher essentiell, um sicherzustellen, dass die im Kindergarten erworbenen Sprach- und Lesegrundlagen systematisch weiterentwickelt werden. Dies erfordert verbindliche Kooperationsmodelle, regelmäßigen Austausch zwischen Fachkräften beider Bildungsstufen sowie gemeinsame Konzepte zur Leseförderung, die den Übergang für Kinder nahtlos gestalten.
6
Ehrenamt als Unterstützung der professionellen Leseförderung etablieren
Ehrenamtliches Engagement kann eine wertvolle Ergänzung zur professionellen Leseförderung sein. In Bildungseinrichtungen sollen daher vermehrt Lesepat:innen eingesetzt werden, um Kindern vorzulesen und nach dem Schuleintritt beim Lesenlernen zu unterstützen. Erfolgreiche Programme haben gezeigt, dass solche Initiativen einen großen Unterschied machen können. Damit Ehrenamtliche jedoch gezielt zur Leseförderung beitragen können, sind Schulungen und Ausbildungen notwendig. Bibliotheken und Elternbildungsangebote können als Plattformen für die Qualifizierung und Vernetzung ehrenamtlicher Lesepat:innen dienen.